Buch - Beispielübung
| Site: | Moodle der Goethe-Universität |
| Course: | Moodle für Lehrende und Kursverantwortliche |
| Book: | Buch - Beispielübung |
| Printed by: | Gast |
| Date: | Thursday, 15 January 2026, 6:27 AM |
Description
Ein Buch ist ein Arbeitsmaterial, mit dem man mehrseitige Lerninhalte in einem buchähnlichen Format darstellen kann. Bereits erstellte Webseiten können direkt in ein Buch importiert werden. Bücher können als Ganzes oder kapitelweise ausgedruckt werden.
Moodle-Bücher bestehen aus einer Reihe von einzelnen HTML-Seiten, die in Kapitel und Unterkapitel aufgeteilt werden können. Ein Unterkapitel kann jedoch nicht in weitere in Unterkapitel gegliedert werden.1. I am digital
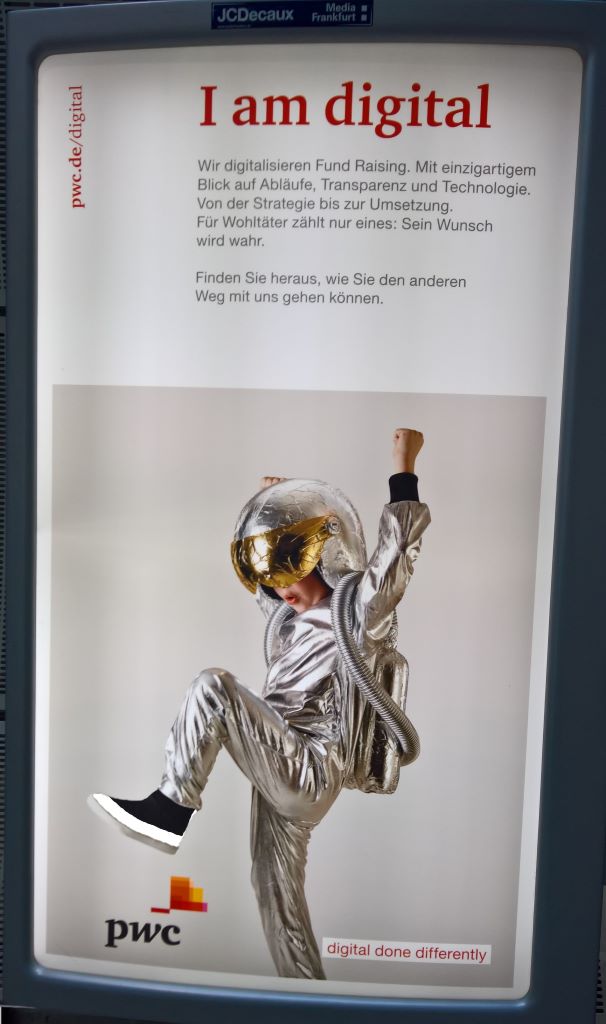
In diesem Buch sind einige Artikel zusammengefasst, die ich im Lauf der letzten Monate zum Thema Digitalisierung in einem ePortfolio gesammelt habe. Hauptzweck war es, Gedanken und Materialien zu sammeln, die in einem Vortrag auf der Jahresversammlung der Gestalttherapeuten dargelegt werden sollen.
Der Anlass bestand allerdings schon früher und macht sich in dem geradezu hysterischen Begeistern oder Begeistern-Machen rund um dieses Thema fest. Und das schafft die Möglichkeit einmal selber fröhlich-poetisch mit der schönen neuen Wirklichkeit umzuspringen.
Der Mensch hat seit seiner Genese, wenn man zumindest in ihrem jüdisch-christlichen Interpretationsrahmen verbleibt, ein Problem mit der Wirklichkeit. In ihr findet er sich als Ausgestoßener, nach der Vertreibung aus paradiesischen Zuständen, wieder, um in ihr im Schweiße seines Angesichts sein mühsames Dasein zu fristen. Hegel schreibt in seiner Geschichte der Philosophie "Im Unglück der Wirklichkeit wird der Mensch in sich hineingetrieben und hat da die Einigkeit zu suchen, die in der Welt nicht mehr zu finden ist." Doch was an sich Grund genug sein könnte, dieser erbärmlichen Angelegenheit ein rasches Ende zu bereiten, findet sein Gegenstück in der göttlichen Order, den Dingen der äußeren Welt Namen und Bedeutungen zu geben und sie sich untertan zu machen. Und so schafft sich der Mensch seine eigenen Wirklichkeiten, eine innere aus Vorstellungen, Gedanken und Systemen, Philosophie und Wissenschaft und eine äußere, die er in Wechselwirkung mit der inneren beobachtet, interpretiert und durch den Einsatz von Werkzeugen und Technologien gestaltet.
Das innere Moment ist der Gedanke, das äußere das Werkzeug. Sie verbindet die Handlung, die in ihrer Beobachtung und Deutung zur neuronalen Verstärkung und zu neuen Verknüpfungen und neuen Gedanken führt, die wieder in der äußeren Welt zum Ausdruck kommen. Was in dieser Beschreibung einer Dynamik noch fehlt, ist die Energie selber, die sie antreibt. Die Angst, Verzweiflung, der Schmerz als Einzelnes, Losgelöstes in einer äußeren Wirklichkeit existieren zu müssen und die Lust, in ihr Befriedigung zu finden und evozieren zu können.
Dies ist, so meine These, der vielleicht notwendige blinde Fleck, um eine innere Wirklichkeit erst entstehen lassen zu können - die gedachte Emanzipation des Geistes von der Wirklichkeit, an die ihn Emotionen letztlich immer noch ketten. Und damit kommen wir zur eigentlichen Frage. Was tun und wollen wir wirklich, wenn wir von der Digitalisierung der Arbeit, der Bildung etc. reden und einem Werkzeug das Vorrecht geben wollen, unser Leben zu gestalten.
Digital first - Bedenken second?
Autor:Ralph Müller
Foto: pwc-Plakat Frankfurter Flughafen Ralph Müller
2. Abschied von Lukas dem Lokomotivführer
In der Süddeutschen Zeitung vom 12. Dezember 2017 lese ich von der Premieren- und Pannenfahrt der Deutschen Bahn auf der neuen ICE Schnellstrecke München – Berlin. Als ICE-Vielfahrer stellen sich bei mir bei der Schilderung der Umleitungs- und Verspätungsorgien von über zwei Stunden die Nackenhaare auf. Dabei soll ein neues digitales Signal- und Steuersystem, European Train Control System (ETCS), unteranderem für das schnelle Zugfahren sorgen. So könnten Züge „dann in einigen Jahren flächendeckend automatisch fahren. Möglicherweise sogar ganz ohne Lokführer. … Die Digitalisierung des Schienenverkehrs würde zwar einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten. Sie könnte aber auch Personalkosten sparen.“ Was macht das nun mit mir, mit uns, wenn wir so etwas lesen. Schnell und pünktlich das ist gut! Und was ist mit dem Personal? Nun, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber es sind selten die Späne, die eine solche Geschichte schreiben.
Autor: Ralph Müller
Es ist unsere Lust an der Perfektion, am alten Longius, Altius, Fortius, die uns glauben macht wir wären auf der Seite des Hobels. Doch das kann eine Täuschung sein. Oder macht sich hier die Maschine mit Hilfe des Menschen nicht einfach frei von dessen Beschränktheit? Das klingt nun arg nach wildester Verschwörungstheorie. Und natürlich kann ein ICE, eine digitale Signalanlage, ein Streckennetz nicht wollen. Aber der Mensch kann wollen, dass sein Beschränktsein in der Welt endlich aufhöre – notfalls auch ohne ihn.
Luciano Floridi schreibt in seinem Beitrag „Die Mangroven-Gesellschaft“ den Effekt der Umhüllung. Er bezeichnet damit das Phänomen, im Englischen auch envelope genannt, dass wir Maschinen in der Regel so konzipieren, dass sie innerhalb einer definierten Umgebung funktionieren. Das ist ihr envelope, ihre Umhüllung. Wir passen uns weniger der Umwelt an, wie es vielleicht noch sogenannten Naturvölkern gelingt (wenn auch mit immer größeren Schwierigkeiten), sondern wir passen unsere Umwelt an, so dass in aktueller Konsequenz „… man die Welt umhüllt, indem man eine feindliche Umgebung in eine digitalisierungsfreundliche Infosphäre verwandelt“. Was umso gerechtfertigter erscheint, je mehr man sich dabei auf Menschenwerk wie Maschinen und Systeme konzentriert. Doch dass, so Floridi, könnte nicht im Sinne des nach Kant aufgeklärten Menschen sein, der stets Zweck und niemals Mittel dazu sein sollte.
Dies könne zum einen darin bestehen, dass in einer IKT-konformen und umhüllten Welt, die dort arbeitenden Systeme zum Handlungssubjekt werden und Menschen in weitestgehend automatisierten Prozessen dort anfordern, wo sie selber nicht tätig werden können, im Verstehen und Interpretieren. (Wohlgemerkt ein Verstehen und Interpretieren in einer IKT-umhüllten Welt im menschlichen Sinne, ist dort zu deren Funktionieren nicht erforderlich!) In der gelebten Praxis sind dies Konzepte wie sie von IKT-getriebenen Firmen wie Amazon beschrieben werden, der Mensch als Mechanical Turk oder „künstliche künstliche Intelligenz“.
Neben dieser eher industriellen Metapher gibt es in finanzmarktwirtschaftlicher Hinsicht ein weiteres Feld der Objektivierung. Nach Floridi besteht keine Geschäftsbeziehung zwischen einem Anbieter und einem Kunden, sondern zwischen Anbieter und dessen Bankkonto bzw. Kreditrahmen. Der menschliche Kunde fungiert in dieser Systemsicht als Schnittstelle, die es zu beeinflussen gilt. Der Kunde wird dabei umso mehr Mittel zum Zweck je stärker er glaubt in den Angeboten seine Bedürfnisse und deren Befriedigung widergespiegelt zu sehen.
3. Digitale Verantwortung - Oxymoron oder zeitgemäße Moralität?
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte und damit wieder einmal jenseits aller Digitalisierung. Denn die Hauptmerkmale der Digitalisierung erfreuen sich wertneutraler Objektivität. Zum einen ist dies hochdifferenzierte Hardware, letztlich Maschinen und zum anderen mathematisch-logisch fundierte Software in Form von Algorithmen und Programmen. Beides hergestellt von Menschenhand, die bei weitem nicht mehr jene Form objektiver Neutralität erreichen kann, da sie von menschlichem Geist und Willen gesteuert wird. Dieser schafft sich daher, in dauerhafter geschichtlicher Veränderung und Anpassung, Regeln und Gesetze, die ihm dabei helfen, dass der Mensch, der hinter ihm steht, sein Handeln verantworten kann. Verantwortung umschließt dabei richtiges und falsches Handeln, da dieses neben der Bewertung seines richtigen oder falschen Ablaufs in seiner moralischen Dimension auch gegensätzlich bewertet werden kann - als Gutes oder Schlechtes. Und dieses ist dann in Bezug auf seine Folgen zu verantworten. Dilemma und Digitalisierung haben die Vorsilbe „Di“ gemeinsam - danach aber trennen sich ihre Wege.
In Artikeln und Buchbeiträgen führt dies zu Überschriften wie „Der Todesalgorithmus“, „Ethische Roboter für die Altenpflege“ oder „Autonome Fahrzeuge: Die Notwendigkeit moralischer Algorithmen“ (Die letzten beiden in 3th1cs – Seite 90 und Seite 102, die erste Zeitungsartikel -> liegt kopiert vor)
Besonders beim Artikel über die Roboter in der Altenpflege fällt auf, dass fast ausschließlich von ethischen Prinzipien und ethischen Entscheidungen die Rede ist während das Wort Verantwortung nur einmal vorkommt und dies in Bezug auf das Entwicklerteam aus KI-Spezialisten und Ethiker, der die „größte Verantwortung“ bei der Gestaltung des ethischen Lernprozesses des Roboters trägt. (S. 97 ebd.). Auch bei dem Artikel zum moralischen Algorithmen drängen sich eher die logischen Wahrheitstafeln in den Vordergrund auf deren Basis komplexe Entscheidungspfade zu ethische vertretbaren Kosten-Nutzenanalysen entstehen können.
Ein verantwortungsfähiges Subjekt tritt in beiden Fällen nicht auf den Plan. Es entsteht bei mir der Eindruck, dass dieses zu Gunsten von sauber beschreibbaren Algorithmen herausgerechnet wird. Ich notiere mir dazu eigene Formeln:
· Verantwortung übernehmen ist ungleich ethische Entscheidungen, die qua Algorithmus berechnet werden können
· Die Eindeutigkeit algorithmischer Entscheidungen ist gleich widerspruchs- und leidensfreien Zuständen eines Paradieses
· Verantwortung übernehmen ist ungleich Paradies
· Digitalisierung ist gleich Hoffnung auf die Rückkehr ins Paradies
Fazit
Digitale Verantwortung ist nur dann kein Widerspruch in sich
selber, wenn klar ist, dass die Verantwortung beim Menschen verbleibt,
auch wenn er kleinere oder größere Teile seiner Handlungsprozesse an
sogenannte intelligente Maschinen delegiert. Eine Verlagerung ist
denkbar und damit letzthin möglich; verlangt aber die klare Einsicht,
dass damit wesentliche Dimensionen menschlicher Existenz aufgegeben
werden. Auch dies muss verantwortet werden und sei es mit dem Risiko und
der Bereitschaft das Risiko zu tragen, dass ein (digitales) Paradies
ohne Menschen auskommen könnte.